|
 
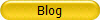
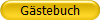
| |
|
Karl Ochantel
Zwischen Wahrheit und Sage
Flurnamen im Elm und Sagen um den Elm
|
Abgedruckt in „60 Jahre Oberpfälzer Waldverein
Vohenstrauß 1985, S. 81-86
Fotos und
Repros: Peter Staniczek |
|
Der Elm ist ein sagenumwobener Waldkomplex
zwischen den Burgorten
Waldau und Leuchtenberg. Der Name Elm bedeutet
wohl Ulme, denn in nächster
Nähe
in Oberlind finden wir die Waldabteilungen Ahorn und Buchen. Diese
Waldnamen
erinnern daran, dass sich der Waldbestand in den letzten
Jahrhunderten
sehr verändert hat, denn Ulmen, Ahorn und Buchen sind als Wälder
tatsächlich
schon „zu suchen". Geheimnisvoll klingt der alte Name Elbenwald.
Sollten
hier Elben, also Elfen gewohnt haben?
Wuchtige Föhren,
gestrüppumwucherte Felspartien, alte Steinkreuze und verwitterte
Grenzsteine geben dem düsteren Waldesinneren eine Stimmung, von der
das Volk behauptet, dass es da drinnen nicht echt geheuer ist. Nach
alten
Erzählungen nimmt hier in stürmischen Nächten die wilde Jagd ihren
Anfang
und zieht südwärts hinüber zum Kalten Baum, wo es dann besonders
toll
zugeht.
|

Karte von Christophorus Vogel, 1600, Detail |
|
Die Mördergrube
Als vor Jahrhunderten noch die Räuberbanden
ihr Unwesen trieben, machte
eine solche auch unsere Gegend unsicher. Sie stand unter dem
Anführer Hans
Greif. In
seinen verschiedenen Verkleidungen, in welchen er auftauchte, einmal
als vornehmer Reisender oder Kaufmann, dann als einfacher Arbeiter, wurde
er oft von seinen eigenen Genossen nicht erkannt und war
gleich darauf wieder spurlos verschwunden. Seine Bande war
vortrefflich organisiert. Sie erstreckte
sich vom Fichtelgebirge, den
ganzen Böhmer- und Bayerischen Wald entlang
bis nach Wien. Auf diesem weitverzweigten Verbrecherfelde waren bald da
bald dort einsame Felsenhöhlen oder Hütten errichtet, welche den
dort stationierten Räubern
als Unterkunft dienten. Eine solche Höhle oder Station
befand sich auch im Elm an der
alten Straße, die den Verkehr zwischen
Regensburg und Eger befördert. An
dieser Altstraße, etwa im Mittelpunkt von Waldau, Kaimling und
Leuchtenberg trifft man auf einen Platz, der von der Bevölkerung
gemieden wurde. Auf einem der Höhenrücken, von wo aus man einen
schönen Rundblick hat, liegt eine Räuberhöhle. Noch heute heißt
dieses Gebiet die
Mördergrube. Dorthin sollen schon im Mittelalter Räuber ihre
Opfer verschleppt haben.
Dort war auch der Schlupfwinkel von zwei
Dieben, die im düsteren
Elmwald den Reisenden auflauerten und raubten und plünderten. Der
eine hieß Wenzelus und war ein in den 30er Jahren stehender stark
gebauter Geselle mit rohem und verwildertem Aussehen. Hinz, der
andere, war vielleicht 10 Jahre jünger.
Köhler gab es in den damaligen Wäldern häufig. Noch heute erinnert
der Flurname „bei der Waldauer Meilerstatt" an dieses Gewerbe.
Auch
Hinz, der
das vertrauenerweckendere Aussehen hatte, gab sich für
einen Kohlenbrenner
aus. In dieser unauffälligen Verkleidung besuchte er die Wirtshäuser
in der
Umgebung, belauschte die Gespräche der Bauern und kundschaftete so
die
ahnungslosen Reisenden und Ortsbewohner aus. |

Bildbaum im Elm, Fritz Schönberger, 1998 |
|

Christophorus Vogel, 1600
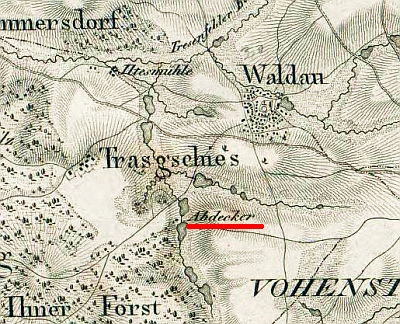
"Abdecker", Top. Atlas des Königreichs Bayern
(1830-1840) |
Der Waldauer Galgen
Bei der Abdeckerei lag der Galgenweiher. Er
ist nun eine Wiese, der Name ist
vergessen. Erhalten hat sich noch der Flurname Galgenstauden. Diese
Flur liegt nach dem Wiegenweiher
in Richtung Trasgschieß
am Neuweiherbach.
Der Abdecker gehörte
zu den unehrenhaften Berufen und vollzog bei Bedarf
auch das Amt des Henkers. Der Volksmund erinnert sich, dass der
Waldauer
Henker „hinten im Wald" wohnte. Das Halsgericht, d. h. die
Strafgewalt über Leben und Tod hatte die Herrschaft. Zur Vollziehung
der Todesstrafe wurden
Galgen errichtet. Diese Galgen standen auf Anhöhen, um die
Herrschaftsgewalt
zu verdeutlichen und die Verbrecher abzuschrecken. In der Karte von
Christophorus
Vogel vom Jahre 1600 sind die verschiedenen Galgen eingezeichnet.
Der
Waldauer Galgen stand auf dem Galgenberg zwischen Erpetshof und
Waldau.
Die Flur
um den Galgenberg hieß die Galgenbergtrad.
Der Galgen bestand aus einem Unterbau, der 3
Holzbalken hielt, die mit
Querbalken verbunden waren. Der Gerichtete
blieb zur Abschreckung hängen,
bis er infolge Fäulnis, Vogelfraß (Galgenvögel) und Schändung (Talisman)
herab in den Unterbau fiel und dann verscharrt wurde. Auch Selbstmörder
wurden hier beim Galgen und nicht in geweihter Erde des Altenstädter
oder Waldauer Friedhofes eingegraben. 1594 heißt es, dass vor etlichen
Jahren ein armer Taglöhner, der sich im Stadl erhängt hatte, von den
Waldauerischen Beamten
abgenommen und unter dem Gericht, also direkt unter dem Galgen
begraben wurde.
Die Richtstätte
soll auf dem Sündersbühl gewesen sein. Dort läutete das
Armesünderglöcklein, wenn am Galgenberg einer gehenkt wurde. Weder
Grundbuch noch Kataster geben Auskunft über die Lage des Sündersbühl.
Ein
alter Waldauer erinnert sich, dass der Sündersbühl unterhalb der
inzwischen
abgebrochenen Schlodermühle am Schlossweiher zu suchen sei. Die
dortige
Anhöhe, ein kleiner Bühl mit einer Baumgruppe, müsse der Sündersbühl
gewesen sein.
|
|
Die Schinderei
Vor
über 100 Jahren waren die „Schoumanner" als Viehdiebe und
Brandstifter berüchtigt. 1889 brannte es in Lennesrieth beim Lindner
und beim Wirt. Die
Schoumanner hatten der Wirtin Schlimmes angedeutet, da diese ihnen
Schweinediebstahl
vorgeworfen hatte. Man vermutet deshalb die Schoumanner als
Brandstifter. Es heißt noch heute, dass diese in der Schuhmannhütte
hinten im
Elm hausten. Die genaue Lage des Häuschens kennt niemand mehr. Ihr
Versteck hatten sie aber in den Löchern der Mördergrube. Noch vor 50
Jahren
zeigte man dort einen verrußten Felsen, bei dem sie ihr Lager hatten
(DO
1936, S. 300). Die Schoumanner hatten die berufliche Aufgabe, dem
verendeten Vieh die Haut abzuziehen, den Balg zu „schinden", und den
Kadaver, auch Schelm,
Aas oder Luder genannt, auf den von der Gemeinde zugewiesenen
Stellen zu
vergraben.
Andernorts weisen die Flurnamen Luderwiesen (bei Altenstadt)
und Schelmacker (bei Tresenfeld) auf diesen Beruf hin. In Waldau gibt es
kurz vor dem Elmwald die
Flur Schinderei. Die Schoumanner waren also Schinder
und Abdecker. Der Ort, wo sie wohnten, hieß Abdeckerei. Die Waldauer
haben davon keine
Erinnerung mehr. Aber bei der Bildung der Steuerdistrikte
im Jahre 1808 gehörte zur
Gemeinde Waldau auch die Einöde Abdeckerei. Die genaue Lage vor dem
Elmwald direkt am Schinderweiher lässt der alte Flurplan
von ca. 1836 erkennen.
|

alter Weg
von Neumühle zu den Handkreuzen, |
|
Das Würfl-Feldkreuz
„Zur Erinnerung an die Mordtat des Mich. Würfel aus Paßenrieth 1863
gewidmet von dessen Sohn Johann Würfel 1882", so lesen wir auf dem
Feldkreuz im Elmwald. Mancher Wanderer mag sich vor diesem Marterl
gefragt haben, ob Würfel der Name des Mörders oder des Opfers war.
Angeblich soll ein Bauer ein Paar Zugochsen
auf den Viehmarkt getrieben
haben. Nachdem er sie gut verkauft hatte,
ging er ins Wirtshaus. Er trank und
prahlte mit seiner vollen Brieftasche, die er
öfters vorzeigte und in der er die Geldscheine durchblätterte. In
feuchtfröhlicher Stimmung trat er kurz vor Mitternacht die Heimreise
an. An der Stelle, wo der Gedenkstein steht, wurde
er erschlagen und ausgeraubt.
Eine andere Schilderung lautet: Hier hat sich
der Xantenbauer von Paßenrieth
auf dem Heimweg vom Viehmarkt in Leuchtenberg verirrt. Ein des Weges
kommender Mann aus einer der nächsten Ortschaften soll sich
angeboten haben, ihn auf den
richtigen Weg zu führen. Als sie sich aber im dichten Wald
befanden, schnitt er ihm von
hinten den Hals ab. Die Tat blieb lange Zeit
ungesühnt. Als sich der Mörder
dem Tatort wieder einmal näherte, soll ihm
der Teufel aufgehockt und ihn
gewürgt haben. Selbigen Tages hat er auf dem Sterbebette seine
ruchlose Tat gestanden und sein Gewissen erleichtert (Laßleben,
DO 1932). Im Sterbebuch des Jahres 1863 findet sich folgender
Eintrag: Würfl Michael,
verh. Bauer in Paßenrieth, 41 Jahre, kath.; Datum des Eintrags:
5. Oktober 1863; Bemerkung: totgeschlagen. Demnach hieß der Getötete
Würfl, zu dessen Gedenken Jahre später sein Sohn dieses Steinmarterl
errichten ließ.
|

Zwischen Neumühle und Handkreuzen |
|
Das Reitgirgl
Gierig wurde Berichten
über Orte, wo es umgeht, und anderen Schauergeschichten
gelauscht. So eine Stelle, wo es umging, war das Reitgirgl, ein
Granitblock auf der höchsten
westlichen Gemarkungsgrenze zu Roggenstein
im Wald
Trüffelschlag. An einem Ort wo es umgeht, ist eine Bluttat geschehen
oder ein Mörder begraben. Vom Reitgirgl erzählt man sich: Im Dorfe
Roggenstein wohnte eine Familie mit Namen Reitgirgl. Die Frau hat sich selbst
umgebracht und damit das
Recht auf ehrenhafte kirchliche Beerdigung verwirkt. An Stricken zog
man sie auf die nahe gelegene Höhe im Trüffelschlag
und ließ sie dort zur
Abschreckung und Sühne liegen. Um die Abscheu gegen
die Selbsthinrichtung
wachzuhalten, nannte man die steinige Höhe das Reitgirgl
|
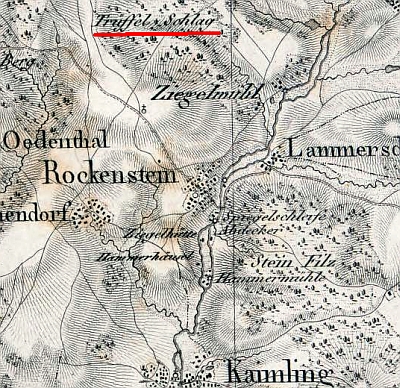
"Trüffel-Schlag", Top. Atlas des Königreichs Bayern
(1830-1840) |
|
Das Zeßmannsriether
Steinkreuz
Die Kunstdenkmäler
des Königreichs Bayern, Bezirksamt Vohenstrauß,
erwähnen beim Dorfe Zeßmannsrieth ein Steinkreuz, das heute noch
erhalten ist. Die Entstehung dieses Marterls kann mit folgender
Begebenheit zusammenhängen:
Am 30. Januar 1550 kamen zwei Landsknechte in
das Dorf, um da zu garten, also zu betteln. Sie trieben wohl
allerlei
üblen Unfug, so dass die Bauern ihnen
beim Verlassen des Dorfes bewaffnet folgten. Da bekamen es die
beiden mit
der Angst
zu tun, sie warfen sich auf die Knie und baten um Gotteswillen ihrer
zu schonen. Aber die erbitterten Bauern haben beide Landsknechte vor dem
Dorf unbarmherzig zu Tod geschlagen. Der Fall führte dann auch noch
zu langen
Streitigkeiten
zwischen Leuchtenberg und Waldau.
|

Steinkreuz Zeßmannsrieth |
|
|
|
|

Buchen-Föhren-Mischwald im Elm |

Fichtenmonokultur im Elm |
|
|
|
|
Die Drei Handkreuze
Eine interessante Gruppe von Steinkreuzen, ein
sogenanntes Steinkreuznest,
sind die drei Handkreuze an einer Weggabel im
Elm. Es sind dies zwei
rechteckige Steine und ein Kreuz. In jedem
dieser Male finden wir eine nach oben gerichtete Hand eingemeißelt.
Etwa 50 Meter westlich davon stoßen wir
auf einen vierten Stein, ebenfalls mit einer Hand. In der Nähe liegt
der
Kreuzsteinacker (Gemarkung Oberlind, PL Nr. 1059).
Bei diesen drei Handkreuzen spricht die Sage
sehr deutlich und kommt der
Wahrheit wohl sehr nahe:
|

Kolorierte Skizze, 17. Jh. |
|
Version 1
Vier Burgherren sollen verabredet haben, hier zusammen zu kommen und
die Grenzen ihrer Herrschaften festzulegen.
Derjenige, der zu spät
komme,
dürfe nicht mit teilen. Es waren dies die Herren von Leuchtenberg,
Roggenstein, Waldthurn und Tännesberg. Der von Tännesberg ist zu
spät gekommen, weil er den weitesten Weg hatte. Als er sah, dass die
anderen
bereits
anwesend waren und die Teilung schon zu Ende war, ritt er seitwärts
in den Wald und schoss sich vom
Pferd herab. Deshalb finden wir den
vierten Stein etwa 80 Schritte
tiefer im Wald.
|

Drei Handkreuze |
|
Version 2
Bis in die 30er Jahre war auch noch folgende
Variation lebendig:
„Bei der
Grenzfestsetzung im Elmholz verspätete sich der Kaimlinger.
Daraufhin
ließen die Herren von Leuchtenberg, Vohenstrauß und Waldau seinen
Stein nicht mehr mit an die Stelle der anderen setzten, sondern der
Kaimlinger musste seinen Stein von den anderen entfernt, nicht an
einen
Weg, sondern im Wald setzen." (Rainer H. Schmeissner, BFO 1984, S.
64-70)
|

hist. Grenzstein im Elm, W(aldau?) |
|
Version 3
Teufelssage:
„Im Elm ist einmal auch einem Mann von Kaimling ein böser
Streich gespielt worden. Der Mann hieß im Volksmund ,der alte
Kaiser'.
Derselbe
ging einmal durch den Wald nach Vohenstrauß. Als er zu den drei
Handkreuzen kam, begegnete ihm ein grau gekleidetes Männlein mit grünem
Filzhut. Dieses hatte einen Korb voll Eier und lud den ,alten
Kaiser' ein, mitzutragen. Als dieser ablehnte, schüttete es ihm den
Korb voll Eier über den
Kopf und verschwand. Der Mann konnte vor Schreck lange nichts
reden, auch gingen die Leute
hinaus an den Ort und fanden auch etwa 300 Stück zerbrochene Eier
bei den drei Handkreuzen liegen. Der ,alte Kaiser'
ließ es sich seine Lebtag nicht
ausstreiten, dass es der Teufel war, denn er
hatte ganz genau die Hörner
gesehen." (Laßleben DO 1938, S. 42)
|
 alter
hist. Grenzstein im Elm, K(aimling?) alter
hist. Grenzstein im Elm, K(aimling?) |
|
Version 4
Eine andere Sage lautet: Da, wo die Kreuze mit
den Schwurhänden
stehen,
sollen die Hohenstaufen als Besitzer von Vohenstrauß, dann die
Waldauer
und die Leuchtenberger ihre Waldungen begrenzt und vermarkt haben.
Oder: Die Ritter der Herrschaften Waldau, Leuchtenberg und Kaimling
lagen in einer ungerechten Fehde. Recht und Gesetz galten ihnen
nichts
mehr, nur die Stärke der Faust war entscheidend. So kam es in diesem
Gebiet immer wieder zu Überfällen und Räubereien. Eines Tages jedoch
hatte man genug von diesen Zuständen und sehnte sich nach einer
Beendigung
der Fehde. So trafen sich die Ritter im Elm, wo ihre Besitzungen
nahe beieinander lagen. Hier einigten sie sich, hoben die
schreckliche Fehde auf, reichten
einander die Hände und gelobten, in Zukunft friedlich miteinander
zu leben. Als Zeit nennt
man das Jahr 1366.
|
|
|
Hand als Rechtszeichen
Dass
die Hand auf einen Vertrag hinweist, kann richtig sein, denn die
Hand
bzw. der Handschuh spielten im Rechtsdenken des Mittelalters eine
entscheidende Rolle. So wurde die Hand gerne auf Grenzmale gesetzt,
vor allem für besonders gefriedete Bezirke. Der Elm scheint so einen
gefriedeten Bezirk
dargestellt zu haben. Ein Teil des Waldauer Elm heißt noch
Grafenholz.
Früher war der ganze Elm landgräflicher Besitz. Das Rechtszeichen
der
abgehauenen Hand ist auch leicht zu erkennen, denn regelmäßig wird
als
abgehauene Hand die Rechte dargestellt, niemals die Linke.
|

Viertes Handkreuz, Foto: P. Staniczek |
|
Alter der Handkreuze
In Brunners Geschichte der Landgrafen von
Leuchtenberg, auf die sich andere spätere
Schilderer stützten, wird - wie Illuminatus Wagner nachweist -
irrtümlich
behauptet, dass diese alten Grenzzeichen schon um das Jahr 1361
erwähnt
werden.
Die Grenzbeschreibung stammt vielmehr aus der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts und führte zu dem
Heidelberger Vertrag, der u.a. im Jahr 1546
die Grenzen zwischen dem .Fürstentum
der obern Pfalz' und der ,Landgrafschaft Leuchtenberg' festlegte. In
dieser Grenzbeschreibung sind neben dem .kalten Bäuml' auch die
,Handkreuze' im Elm angegeben. 1583 schreibt der
Pfleger
von Tännesberg an den Pfleger von Leuchtenberg: Nachdem bei Oberlind
auf der Straße, wie man gen Weiden geht, 3 Marksteine gesetzt
worden, welche das Amt
Tännesberg, die Landgrafschaf t Leuchtenberg und
die Herrschaft Waldau scheiden,
von denen einer verloren ging, habe er von
der Amberger Regierung Befehl
erhalten, denselben wieder aufzurichten." In
einer Grenzbeschreibung von 1606
sind die gleichen Grenzen wieder erwähnt. Nach dem
Blutzehentkataster trafen hier die Grenzen von Leuchtenberg,
Waldau, Kaimling und Vohenstrauß
aufeinander und noch heute stoßen bei
den drei Handkreuzen die fünf
Gemarkungen Lerau, Leuchtenberg, Kaimling,
Waldau und Oberlind zusammen.
Auch fünf Wege gehen hier auseinander und
zwar in die genannten
Ortschaften. |

Handkreuz im Elm, Hand noch erkennbar, Datierung
(1765) erst später eingemeißelt, Alter zwischen 1300 und 1546, Foto:
P. Staniczek |
|
|
|
|
