|
  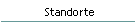
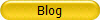
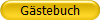
| |
|
Steinkreuze (Peter Staniczek) |
|
Wer von Eslarn nach Oberlangau
fährt,
entdeckt an einer alten Grenzlinie (heute Landkreisgrenze zwischen Neustadt a.d.Waldnaab und Schwandorf) etwa 50 m
östlich der neu errichteten
erhöhten Straße über den Ödbach eine Rarität im Raum
Eslarn-Schönsee, ein Steinkreuz. Ursprünglich stand es
näher an der Straße und
wurde bei der Neutrassierung verlegt.
Die Oberlangauer erzählen heute
noch, dass hier in den "Eslarner Äckerwiesen" (Volksmund: "Eselswiesen") die
Hirten von Oberlangau und den
Höfen („vo da Hief“) miteinander gerauft hätten, wobei
einer oder gar beide zu Tode gekommen
seien. Das angrenzende Waldstück nördlich des Baches
trägt
noch den Namen "Oberhöfer Hut".[1]
Die vorliegende Sage weist auf
die Bedeutung
dieses Steinkreuzes als Sühnekreuz hin, lässt es damit historisch auch
einigermaßen einordnen, wobei auch die zusätzliche Funktion als Grenzzeichen durchaus
möglich erscheint.
Steine dieser Art wurden etwa zwischen 1300 und 1600
als Zeichen der Sühne für begangenen Totschlag errichtet.
Konnte sich der Täter mit den
Angehörigen des Erschlagenen
vergleichen, so wurde er nicht von Gerichts wegen
verfolgt oder verurteilt.
So beschwerte sich im Jahre
1534 ein Wolf von Guttenstein zu Neustadt bei dem Pfalzgrafen Friedrich, "dass die
Weidener ein Steinkreuz zwischen der Salzbrücke und dem Forst aus der
Herrschaft Störnstein und Neustadt entfernt und in ihrem neu aufgerichteten
Friedhof zu Weiden eingemauert
hätten. Dies Kreuz gelte als
Markungszeichen und
sei daher wieder an seinen Ort zu bringen". Der Rat der
Stadt Weiden antwortete u.
a. mit einer Erklärung
der tatsächlichen Funktion dieses
Kreuzes, "so durch Einen von Neustadt eines Abgeleibten
halber gesetzt sein
soll", "es handle sich um kein Grenz-, sondern um ein Totschlagzeichen, da es allenthalben gebräuchlich, dass an dem Orte, an
welchem Tot schlag geschehen, auf der Landstraße Kreuze gesetzt
werden", und weiter: "Das Kreuz ist auf beweich bemelter
Herrschaft Störnstein und Neustadt, mit der der Täter sich umb
den Totschlag vertragen, gesetzt worden, auch der tote Körper
in bemelter Herrschaft
begraben alles ohne männiglich Einrede".
[2]
Zu einem solchen Vergleich (Sühnevertrag) gehörte
u.a.:
 |
für das Seelenheil des Toten eine bestimmte Anzahl von
Messen lesen zu lassen; |
 |
der Kirche
dafür Wachs zur Verfügung zu stellen;
|
 |
die Beerdigungskosten zu übernehmen;
|
 |
Wallfahrten zur
eigenen Buße und zum Seelenheil des Getöteten zum Teil
bis nach Rom zu unternehmen; |
 |
den Hinterbliebenen ein "Wer- oder Manngeld" zu
entrichten; |
 |
schließlich neben weiteren Bußen am Ort der
Tat ein steinernes Kreuz errichten
zu lassen.[3]
|
Die Erinnerung an den Toten
sollte dadurch
lange wachgehalten werden, die Gebete der Vorübergehenden ihn,
der ja in der Regel nicht
von einem Geistlichen mit den Sterbesakramenten versehen
worden war, dem Himmel näher bringen, ebenso wie die vielen
anderen Sühnemaßnahmen.
Sühnekreuze zeigen oft eingemeißelte Symbole, mögliche Hinweise auf die Identität des
Opfers, des Täters oder die
Tat. Rätselhaft erscheinen die Zeichen auf dem
vorliegenden Stein, vier Kerben in der Anordnung "I : I", sie
werden wohl nie eindeutig zu
erklären sein, ein Sühnevertrag konnte bisher noch nicht
gefunden werden.
Im
Jahre 1533 wurden durch die Einführung
der Halsgerichtsordnung Kaiser
Karls V. die privaten Abmachungen durch die Tätigkeit
ordentlicher Gerichte ersetzt. Obwohl offiziell abgeschafft,
hielten sich die Sühneverträge aber noch bis zum Ende des
16. Jahrhunderts.
Die Beschädigung des Oberlangauer
Steinkreuzes an Kopfstück
und Querbalken, einer ist fast ganz abgeschlagen,
geht wahrscheinlich ebenfalls ins
16. Jahrhundert zurück. Mit Pfalzgraf
Friedrich III. aus dem Hause Simmern
gelangte 1559 ein Anhänger des
Schweizer Reformators Calvin an die
Regierung in den Pfälzer Landen. Er
ging über die Maßnahmen
seiner Vorgänger Ottheinrich und Friedrich II., die die
Kirchengüter säkularisiert (=
verweltlicht) hatten, weit
hinaus. So befahl er die Entfernung und Vernichtung
aller religiöser Darstellungen und Ausschmückungen wie Altäre,
Taufsteine,
Sakramentshäuschen, Kreuzwege,
Ölberge und dergleichen.[4]
Möglicherwiese erklärt dieser Kulturvandalismus
das Fehlen von Steinkreuzen
im Gebiet Eslarn - Schönsee, allerdings nicht das relativ
häufige Vorkommen in
den benachbarten Gebieten.
Im Volksmund bezeichnet man sie
auch gern als "Schwedenkreuze", "Pestkreuze"
oder "Hussitenkreuze". Von den letzteren,
die an Verbrechen der oft
grausamen Hussitenkriege des 15.
Jahrhunderts erinnern, von
denen auch das Gebiet um Eslarn nicht verschont
blieb, soll sich in der Nähe
von Putzenrieth ein Exemplar befunden haben.[5] Vermutlich am alten Weg von
Putzenrieth über den
Eiterbach nach
Heumaden gelegen, konnte es von dem Heimatforscher Michael Hardt
aber bereits in den
30-er Jahren nicht mehr aufgefunden werden. Niemand
weiß, wo es hingekommen ist.[6]
Das Fehlen von Steinkreuzen im
Eslarn-Schönseer
Raum glauben die Volks- und
Rechtskundler mit der schon erwähnten Bilderstürmerei des
16. und der Säkularisation
des beginnenden 19.
Jahrhunderts sowie der durchaus denkbaren Verwendung
von weniger haltbaren
Holzkreuzen anstelle der aufwendigeren und teuereren
Steinkreuze erklären zu
können. Möglicherweise waren aber die Bewohner unseres
Landstriches damals nicht so rauflustig
oder einfach zu arm.
Quellen:
[1]
Rainer H. Schmeissner, Steinkreuze in der Oberpfalz,
1977, S. 244 - In Josef Hanauers "Heimatbuch der Marktgemeinde Eslarn", Eslarn 1975,
S. 69 f., finden wir für das Jahr 1494 einen historisch
belegten Streit unter verschiedenen Besitzern der "Öde
zu Altmansreut", der
mit einem Vergleich endete. Dieser
Streit wird aber nicht im Zusammenhang mit der Errichtung eines Steinkreuzes erwähnt.
[2] Wolfgang Bauernfeind, Aus dem Volksleben,
Neudruck 1979, OWV
Windischeschenbach, S. 134 f.
[3]
L. Wittmann, Was bedeuten die alten Steinkreuze?, Beilage zu "Das Steinkreuz", Mitteilungs-Blätter, Nürnberg 1961, Heft 2
[4] Gertrud Benker, Heimat Oberpfalz,
Regensburg 1981, S. 130, 132
[5]
Michael Hardt, Die Flurdenkmale des Landkreises Vohenstrauß, in Das Steinkreuz, Nürnberg 1961, Heft 2, S. 7
[6] Rainer H. Schmeissner,
Steinkreuze in der Oberpfalz,
1977, S. 203 - Rainer H. Schmeissner, Oberpfälzer Flurdenkmäler,
Regensburg 1986 - Benno Hubensteiner, Bayerische
Geschichte, München 1980
|

Steinkreuz in Altenstadt bei Vohenstrauß vor der
Ortsverschönerung |

Dasselbe Steinkreuz nach der
Ortsverschönerung einige Meter zur Straße hin versetzt (Streusalz!) und
strahlend bzw. gestrahlt (ursprünglich eingemeißelte Pflugschar ist
nicht mehr zu erkennen). Denkmalpflege zweimal ausgehebelt!
|
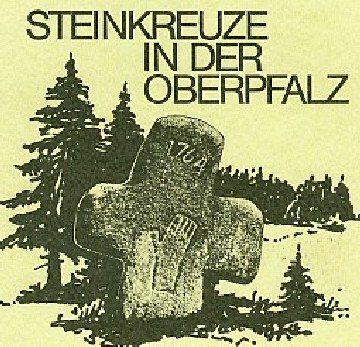
Reiner H. Schmeissner, Steinkreuze in der
OberpfalzRegensburg, 1977
Auf dem Titel befindet sich eines der
Handkreuze im Elm bei Vohenstrauß |
|
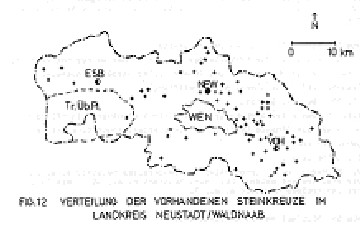
Reiner H.
Schmeissner, der wohl kompetenteste Kenner der Steinkreuze in der
Oberpfalz hat in seinem Standardwerk für den Landkreis Neustadt an der
Waldnaab 78 Exemplare aufgelistet, von denen sich der überwiegende Teil
östlich der Naab, also im Nördlichen Oberpfälzer Wald befindet. Die
Bestandsaufnahme erfolgte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Im
Folgenden sollen nach und nach diese sagenumwobenen, steinernen
Geschichtszeugen vorgestellt werden. |
|
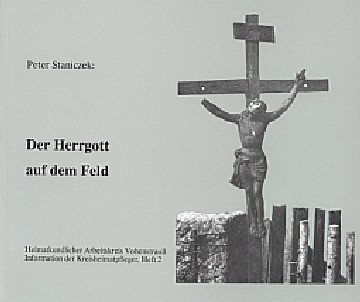
Der Artikel "Steinkreuze" stammt aus:
Peter Staniczek, Der Herrgott auf dem Feld,
Information der Kreisheimatpfleger, Heft 2, Vohenstrauß 1990, S. 6 - 9 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
